
von Milena Michiko Flašar.
Die rot-weiß gefleckten Karpfen auf dem Titelbild, dazu der geheimnisvolle Titel: „Ich nannte ihn Krawatte“ und meine Neugierde ist geweckte.
Auf den ersten Blick hat das Buch schon mal beste Voraussetzungen, von mir gemocht zu werden:
- ein schönes Titelbild
- eine Geschichte, die in Japan spielt
- kein dicker Schinken
- Original in Deutsch. Also keine Übersetzung aus dem Japanischen. Damit habe ich manchmal meine Probleme.
Die Autorin Milena Michiko Flašar ist in St. Pölten geboren. Ihre Mutter ist Japanerin, ihr Vater Österreicher. Sie lebt als Schriftstellerin in Wien und hat 2012 diesen Roman geschrieben, der mit dem österreichischen Literaturpreis Alpha ausgezeichnet wurde.
Ich bin keine Klappentext-Leserin.
Auch keine, die den Text auf dem Buchrücken liest und dann entscheidet: Lesen oder nicht?
Für mich zählt die erste Seite.
Und die ist ganz nach meinem Geschmack: Kurze Kapitel und kurze Sätze.
Das erste Kapitel besteht aus gerade mal aus vier Zeilen.
Beim zweiten Kapitel ist klar: es handelt sich hier um einen Rückblick.
Schnell zieht mich der Roman in seine Geschichte. Nach wenigen Minuten bin ich schon bei Kapitel 7 angekommen. Manchmal stolpere ich über die Sätze, die keine sind. Da fehlt hier und da ein Verb. Druckfehler? Wohl kaum.
Erst ab Kapitel 13, nachdem ich den Erzähler in diesem ruhigen Roman schon etwas besser kennenlernen konnte, ergeben die unvollständigen Sätze einen Sinn.
Worum geht es?
„Im Park war er der einzige Salaryman. Im Park war ich der einzige Hikikomori. Etwas stimmte nicht mit uns. Er sollte eigentlich in seinem Büro, in einem der Hochhäuser, ich sollte eigentlich in meinem immer, zwischen vier Wänden hocken. Wir sollten nicht hier sein oder wenigstens nicht so tun, als ob wir hierher gehörten.“ (Zitat / Kapitel 13)
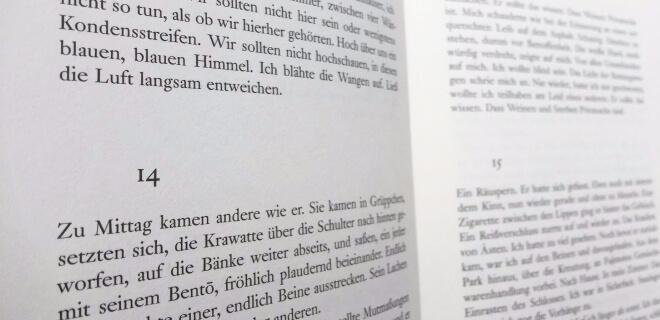
Der 20-jährige Taguchi Hiro, der diese Geschichte erzählt, hat sich bewusst aus der japanischen Gesellschaft ausgeschlossen.
Er ist ein Hikikomori.
Seit 2 Jahre verkriecht er sich im Haus seiner Eltern, in seinem abgedunkelten Zimmer. Er scheut den Kontakt zur Welt, zu den Menschen, sogar zu seinen Eltern. Seit seines Rückzuges hat er nicht mehr gesprochen. Doch nun wagt er sich zum ersten Mal wieder raus in den Park. Sehr scheu und sehr vorsichtig.
Irgendwann taucht ein ältere Mann auf der gegenüberliegenden Bank auf. Und den nennt er zunächst mal Krawatte:
Der 58-jährige Ōhara Tetsu ist gekleidet in Anzug, Hemd und Krawatte, wie ein typischer japanischer Angestellter. Vor zwei Monaten hat er allerdings seinen Job verloren.
Aus Scharm und Angst hat er seiner Frau nichts davon erzählt und verlässt nach wie vor jeden Morgen das Haus, als wäre alles beim Alten. Seinen Tag verbringt er dann im Park auf der Bank oder an Regentagen in einem verrauchten Café.
Das alles erfährt der Leser aber erst viel später. Denn am Anfang ist da nur ein säufzender Mann auf einer Bank.
Die zwei Männer begegnen sich nun täglich im Park. Nähern sich vorsichtig an und kommen langsam ins Gespräch. Mit der Zeit entwickelt sich eine sanfte Freundschaft. Sie beginnen sich ihre Geheimnisse, Beweggründe, Ängste und Sorgen anzuvertrauen.
Was ist ein Hikikomori?
Worterklärung aus dem Roman:
„So werden in Japan Personen bezeichnet, die sich weigern, das Haus ihrer Eltern zu verlassen, sich in ihrem Zimmer einschließen und den Kontakt zur Familie auf ein Minimum reduzieren. Die Dauer variiert. Manche verbringen bis zu fünfzehn Jahre oder sogar länger als Eingeschlossene. Wie viele Hikikomoris es gibt, liegt allerdings im Dunkeln, da viele von ihnen aus Angst vor Stigmatisierung verschwiegen werden. Schätzungen zufolge dürften an die 100.000 bis 320.000 vor allem junge Menschen betroffen sein. Als hauptsächlicher Grund gilt der große Leistungs- und Anpassungsdruck in der Schule und Gesellschaft.“
Das Thema ist mir in Japan einige Male begegnet.
Kennengelernt habe ich solche zurückgezogenen Menschen allerdings nie.
Als Lehrerin an einer Junior High School (12 bis 15 Jahre) gab es ein paar Schüler, die zwar in den Namenslisten der Klassen auftauchten, aber nie in die Schule kamen. Lehrer klärten mich darüber auf, dass sie aufgrund von psychischen Problemen nicht zur Schule gehen könnten. Ich stellte mir darunter immer eine Art Phobie vor, habe aber nicht weiter nachgefragt.
Damals fiel der Begriff Hikikomori – die im Käfig eingeschlossenen hab ich das damals für mich übersetzt. Offen haben auch die Lehrer damals nicht darüber sprechen wollen. Viel habe ich deshalb nicht darüber erfahren können.
Die Beweggründe, dass man sich aus der Gesellschaft zurückzieht, sind bei jedem Hikikomori anders. Richtig vorstellen konnte ich mir das aber nie.
Der Roman schafft es, dass ich mich in die Hauptperson hineinversetzen, mitfühlen und mitleiden kann.
So tun als ob
Seinem Partner vorzuspielen, man gehe zur Arbeit, obwohl man schon seit Monaten den Job verloren hat – auch etwas, was ich mir nur schwer vorstellen kann.
Was für eine Kraft muss es täglich kosten? Wie geht man da mit seinem schlechten Gewissen um? Und wie regelt man das eigentlich finanziell? – Diese Fragen stelle ich mir dabei. Auf einige meiner Fragen bekomme ich Antworten. Das mit dem Geld wird leider wieder nicht geklärt. Da hätte ich mir eine kurze Erklärung gewünscht.
Auf sehr anschauliche Art beschreibt die Autorin, wie die japanische Mentalität hier wieder eine wesentliche Rolle spielt, ohne zu viel erklären zu müssen. Auch jemand, der Japan und das Leben dort nicht kennt, kann sich gut in die beschriebenen Situationen hineinversetzen
Das Schlüsselthema bleibt immer präsent:
Menschen, die nicht in die Gesellschaft passen – passen wollen – passen können.
Worum geht es noch?
Es geht bei „Ich nannte ihn Krawatte“ auch um die Sinnfrage: seinem Leben einen Sinn geben und nach dem Sinn des Lebens und des Weiterlebens suchen.
Soziale und kulturelle Aspekte Japans werden durchleuchte. Immer mit einem Blick auf die japanische Mentalität:
- Der Ehemann, der sich der Frau nicht würdig fühlt
- Die Familie, die nicht miteinander zu reden scheint und sich „mit Hilfe des Uneigentlichen über das Eigentliche verständigten“ (Zitat aus Kapitel 114)
- Das Wahren des Gesichtes in der Öffentlichkeit
- Das japanische Bild von Behinderten
Und nicht zuletzt geht es um das Thema Freiheit im weitesten Sinne.
„Es muss schlimm sein. Ohne Erinnerung. Aber vielleicht nicht so schlimm, wie man sich’s denkt. Ich meine. Wenn man alles vergessen würde. Würde man dann nicht auch alles vergeben? Sich selbst und dem anderen? Wäre man nicht frei von Reue und Schuld?…Nein, nicht wahr, das wäre zu einfach. Um zu vergeben, um wirklich frei zu sein, muss man sich erinnern. Tag für Tag.“ (Zitat Kapitel 37)
Zu viel verraten möchte ich hier aber nicht.
Mich hat das Ende überrascht und so traurig viele Passagen des Romans auf mich gewirkt haben, die Hoffnung kommt hier nicht zu kurz.
Kein Urlaubslektüre – soviel steht fest.
Dazu ist es zu tiefgründig, zu bedrückend, sehr ehrlich und schonungslos erzählt. Mich hat es an vielen Stellen sehr nachdenklich gestimmt.
Und so japanisch, wie es vielleicht auf den ersten Blick scheint, ist es dann gar nicht, wenn es darum geht, mitzuhalten, sich anzupassen und der ewige Versuch jemand sein zu wollen, der man nicht ist.
Mein Fazit
Definitive eine Leseempfehlung für Japan- und Nicht-Japan-Interessierte, an einen regnerischen Tag auf der Couch.
Autorin: Milena Michiko Flašar
Titel: Ich nannte ihn Krawatte
Taschenbuch: btb Verlag (144 Seiten)
8,99€
HIER KAUFEN ODER EINEN BLICK INS BUCH WERFEN *
Weiter Bücher von Milena Michiko Flašar
* Alle Links führen dich auf Amazon.de (Werbe- / Affiliate-Link).
Bei einer Bestellung unterstützt du mich mit einem kleinen Beitrag.
Für dich entstehen selbstverständlich keine Mehrkosten.
Kennst du das Buch oder einen anderen Roman der Autorin Milena Michiko Flašar?
Erzähle mir von deinem Eindruck?
Teile den Artikel gerne auch mit Freunden, die das interessieren könnte:


Ich finde das Buch ist unfassbar langweilig, noch nie so etwas langweiliges Gelesen als Schullektüre vor allem so viele Tote und so viele Namen die alle so kurz da sind, kann mann sich kaum was merken